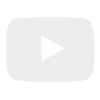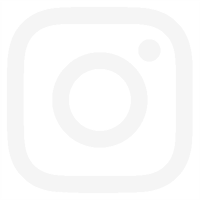Bei konventionellen Fahrzeugmodellen befindet sich meist sämtliche Antriebstechnik unter der Motorhaube. Damit wird die nötige Verbindungen zwischen den Elementen zwar kurz gehalten, jedoch leidet mitunter die Gewichtsbalance des Fahrzeugs. Diese ist gerade für Modelle mit Heckantrieb von großer Bedeutung, bei denen die antreibende Hinterachse oftmals einen zu geringen Anpressdruck erfährt. Eine mögliche Alternative stellt dabei die Transaxle-Bauweise dar…
Das Transaxle-Prinzip bringt Balance ins Auto
Der Begriff Transaxle (hergeleitet aus dem Englischen transmission = Getriebe und axle = Fahrzeugachse) bezeichnet eine besondere Antriebsbauform, die speziell Fahrzeugen mit Heckantrieb dient. Hierbei sitzt der Motor in der Frontpartie, Antrieb und Getriebe sowie ggf. Differenzial platziert man in einem gemeinsamen Gehäuse an der Hinterachse. Die Verbindung zwischen dem Gehäuse und dem Motor erfolgt hier durch eine Transaxle-Welle. Meistens ist bei dieser Bauweise auch die Kupplung hinten mit untergebracht, sodass die Transaxle-Welle lediglich einfache Drehmomente zwischen Motor und Transaxle-Gehäuse übertragen muss.
Der große Vorteil dieser Bauweise liegt eindeutig in der deutlich besseren Gewichtsverteilung zwischen vorderem und hinterem Fahrzeugteil. Die Balance ermöglicht ein besseres Handling des Gefährts, wirkt der Tendenz zum Fahrzeugausbruch entgegen und ermöglicht eine größere Kraftübertragung auf die Hinterräder. Neben der Handhabung ergeben sich weitere technische Vorteile aus der Transaxle-Bauweise: Die thermische Belastung des Getriebes sinkt, da keine Motorwärme auf dieses einwirkt, zudem wird durch die Nähe von Kupplung und Getriebe die Getriebesynchronisierung erleichtert.
Nissan GT-R als Sonderfall des Transaxle-Prinzips
Auch in puncto Sicherheit bietet dieses Prinzip weitere Pluspunkte. Im Falle eine Frontalaufpralls mit anderen Fahrzeugen, werden durch die starre Transaxle-Welle einwirkende Kräfte zu einem nicht unerheblichen Teil zum hinteren Abschnitt des Autos und auf die Hinterachse geleitet bzw. dort kompensiert. Hingegen wird durch die Welle zwischen Motor und Transaxle-Gehäuse der Komfort etwas gedämpft. Das passiert, da die Lagerung der Welle mit höher Geräuschkulisse und höherem Verschleiß verbunden ist. Hierzu werden ggf. Gelenkscheiben zum Einsatz gebracht, um dem besagten Effekt entgegen zu wirken. Bei Limousinen mit Stufenheck-Bauweise fällt die Transaxle-Bauweise möglicherweise zu Lasten des Gepäckraumes.
Soweit man ein manuelles Schaltgetriebe verwendet, kann durch das ebenfalls nach hinten verlagerte Schaltgestänge die Schaltpräzision leiden. Aus diesem Grund baut man im Transaxle-Prinzip meist ein Automatikgetriebe ein. Ein klassisches Beispiel stellen dabei einige Sportwagen (DB9, DBS, V8 Vantage) des britischen Herstellers Aston Martin, sowie die Modelle Mercedes SLS AMG dar. Ausnahmen bestätigen jedoch auch hier die Regel. Beim Nissan GT-R wird ebenfalls nach diesem Prinzip gebaut. Allerdings mit einer zweiten Antriebswelle. Diese befindet sich zwischen dem hinten liegenden Getriebe und der Vorderachse, da der GT-R ein Allradsportler ist.
Foto: wikipedia.de / Gwafton
Datum der Erstveröffentlichung: 21.10.2014